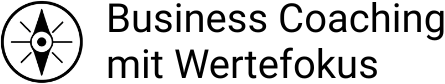Perspektivwechsel
Perspektivwechsel beschreibt die bewusste Entscheidung, eine Situation, ein Problem oder eine Beziehung aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Dadurch werden blinde Flecken sichtbar, festgefahrene Annahmen gelockert und neue Lösungspfade eröffnet. In Kreativ-Workshops, Design-Thinking-Sprints oder Konfliktmoderationen dient der systematische Blick von außen als Katalysator für Innovation, Empathie und Entscheidungsqualität.
Typische Techniken reichen von Rollentausch-Übungen und „What-If/Wass-wenn?“-Fragen bis zu Reframing-Methoden, bei denen ein Sachverhalt in einen völlig neuen Kontext gesetzt wird. Solopreneure nutzen den Wechsel der Perspektive, um Produktideen gegen echte Kundenbedürfnisse zu spiegeln oder Preisstrategien aus Sicht des Käufers zu prüfen, ohne kostspielige Feldtests. Mit der Hilfe der KI lassen sich ebenfalls schnelle Perspektivenwechsel kosten- und zeitgünstig einnehmen.
Tipp:
Wenn Du gerade einen Perspektivenwechsel brauchst, setze Dich beispielsweise an ChatGPT. Lass Dich herausfordern und wenn Du möchtest, kannst Du ChatGPT eine spezielle Person, einen Kunden oder jemand anderen sein lassen, um es noch spezifischer zu machen.
Weitere lesenswerte Glossar-Artikel:
Häufig gestellte Fagen (FAQ) zum Perspektivwechsel
-
Er bezeichnet das aktive Einnehmen eines alternativen Standpunkts – zum Beispiel des Kunden, Lieferanten oder künftigen Ichs –, um Sachverhalte objektiver zu bewerten und kreative Optionen zu entdecken.
-
Konfliktklärung: Zwei Teammitglieder argumentieren jeweils aus Sicht des anderen und entdecken gemeinsam Überschneidungen.
Produktentwicklung: Gründerin skizziert eine Customer-Journey aus Sicht einer Person mit wenig Fachwissen und stößt auf vereinfachungswürdige Schritte.
Preisgespräch: Berater kalkuliert seinen Wertbeitrag als eingesparte Kundenuhr statt interner Tagessatzlogik – und erhöht so die Abschlussquote.
-
Rollenspiele ohne Vorbereitung, die in Karikaturen enden; Pseudo-Empathie („Ich weiß schon, wie der Kunde denkt“) ohne Daten; oder willkürliche „Crazy-Ideas“, die zwar unterhalten, aber keinerlei Bezug zum Problem halten.
-
Ausgangsfrage klar definieren.
Relevante Stakeholder oder Zeitachsen wählen (Kundin, Konkurrent, Zukunfts-Ich, 80-jährige Version von Dir).
Mit Leitfragen oder Methoden wie 6-Hüte-Denken, Rollenkarte oder „Taschentuch-Methode“ die neue Sicht systematisch durchspielen.
Erkenntnisse protokollieren, überlappende Muster identifizieren, anschließend konkrete Handlungsschritte ableiten und testen.