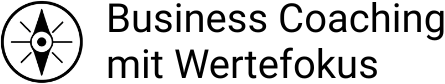Impostor-Syndrom überwinden: Wenn Du Dich wie ein Hochstapler fühlst
Die E-Mail lag seit Stunden in meinem Postfach. Ein Angebot für ein Beratungsprojekt. Mein damaliger Tagessatz: 800 Euro.
Während ich auf „Senden” starren sollte, kreisten dieselben Gedanken in meinem Kopf:
„Wer bin ich denn, dass ich so viel verlangen kann? Was macht mich besser als andere? Bin ich nicht einfach nur ein Dummschwätzer? Ein Hochstapler?”
Falls Dir diese Gedanken bekannt vorkommen, bist Du nicht allein. Du leidest wahrscheinlich unter dem, was Psychologen das Impostor-Syndrom nennen, der tiefen Überzeugung, nicht gut genug zu sein, obwohl alle Fakten das Gegenteil beweisen.
Aber hier ist die Sache: Das Hochstapler-Syndrom ist nicht nur ein bisschen Selbstzweifel. Es ist oft das Symptom eines tiefer liegenden Problems, das in der Kindheit entstanden ist.
Was ist das Hochstapler-Syndrom wirklich?
Das Impostor-Syndrom wurde erstmals 1978 von den Psychologinnen Pauline Clance und Suzanne Imes beschrieben. Sie untersuchten erfolgreiche Frauen, die trotz offensichtlicher Leistungen und Erfolge das Gefühl der Unzulänglichkeit nicht loswerden konnten.
Diese Frauen schrieben ihre Erfolge externen Faktoren wie Glück oder äußere Umstände zu, statt ihre eigenen Fähigkeiten anzuerkennen. Sie lebten in der ständigen Angst, als Betrüger entlarvt zu werden.
Aber das Impostor-Phänomen geht tiefer als die ursprüngliche Forschung zeigt.
Als jemand mit psychotherapeutischer Ausbildung kann ich Dir sagen: Das Imposter-Syndrom ist selten ein isoliertes psychologisches Phänomen. Es ist meist das Symptom eines Entwicklungstraumas – emotionaler Verletzungen aus der Kindheit, die bis heute nachwirken.
Ursachen: Wo das Hochstapler-Syndrom wirklich herkommt
Um das Impostor-Syndrom zu verstehen, müssen wir zu seinem Ursprung: Deiner Kindheit.
Als Kind bist Du natürlicherweise in Deinem Selbstwert verankert. Du hast Ideen, Du willst diese ausleben, Du bist spontan und authentisch.
Dann kommt ein „Schlag” von außen. Ein Erlebnis, das Dich aus diesem natürlichen Sein herauswirft.
Typische Sätze, die das Hochstapler-Phänomen begünstigen:
„Wenn die Großen reden, sind die Kleinen ruhig”
„Du schaffst das doch nie”
„Du bist nicht gut genug” oder „Du bist ein Versager”
„Warum solltest Du das schaffen?”
„Erfolgreiche Menschen sind gefährlich”
„Reiche Menschen sind böse”
Aber es geht nicht nur um Worte. Körperliche Gewalt, das ständige Unterbrechen beim Sprechen, oder die Aufforderung, ruhig zu sein, wenn Du eigentlich das Bedürfnis hattest zu reden – all das prägt sich tief ein.
Erwachsene sagen dann später oft: „Ich war ja als Kind aber frech.” Aber als Kind hast Du das anders erlebt: Du hast Dich unterdrückt und schlecht gefühlt.
Hier eine wichtige Frage:
Wie oft muss ein Kind von einem Hund gebissen werden, um Angst vor Hunden zu entwickeln?
Einmal reicht.
Genau das Gleiche gilt für diese traumatisierenden Erfahrungen. Ein einziges Mal Gewalt kann ausreichen, um eine lebenslange Verhaltensveränderung zu bewirken, die sich später u.a. im Imposter-Syndrom ausdrücken kann.
Die vier häufigsten Selbstzweifel/Impostor-Typen
Nicht jeder erlebt das Hochstapler-Syndrom gleich. Hier sind die vier häufigsten Muster:
1. Der Perfektionist
„Wenn es nicht 100% perfekt ist, bin ich ein Versager.”
Du setzt Dir unrealistisch hohe Standards und wertest jeden kleinen Fehler als Beweis dafür, dass Du nicht gut genug bist. Perfektionismus wird zu einem Gefängnis, das Dich davon abhält, überhaupt anzufangen.
2. Der Glücks-Attribuierer
„Das war nur Zufall, kein echter Erfolg.”
Du schreibst Deine eigenen Erfolge Glück, Timing oder anderen Menschen zu. Die Vorstellung, dass Du tatsächlich kompetent sein könntest, fühlst sich falsch an.
3. Der Vergleicher
„Alle anderen sind besser als ich.”
Ständig schaust Du auf Social Media, was andere machen. LinkedIn wird zur Tortur, weil jeder erfolgreicher zu sein scheint. Du übersiehst dabei, dass Menschen online nur ihre Highlights teilen.
4. Der Expertise-Zweifler
„Wer bin ich denn, dass ich darüber rede?”
Obwohl Du jahrelange Erfahrung hast, zweifelst Du an Deiner Berechtigung, als Experte aufzutreten. Die Angst, dass jemand merkt, dass Du „nicht alles weißt”, lähmt Dich.
Erkennst Du Dich wieder?
Die meisten Menschen haben Anteile von mehreren Typen.
Gesunder Selbstzweifel vs. krankhaftes Impostor-Syndrom
Hier ist etwas Wichtiges: Nicht jeder Selbstzweifel ist schlecht.
Gesunde Selbstreflexion hilft Dir dabei, Dich zu verbessern und gründlich zu arbeiten. In einer Zeit, in der Qualitätsstandards oft sinken, kann ein gewisser Selbstzweifel sogar wertvoll sein.
Gesunder Selbstzweifel:
Motiviert Dich zur Reflexion
Hält Deinen Qualitätsstandard hoch
Schützt vor Selbstüberschätzung
Macht Dich offen für Feedback
Krankhaftes Impostor-Syndrom:
Führt zur Selbstsabotage
Hindert Dich daran, Deinen Bedürfnissen nachzugehen
Erzeugt Leidensdruck: Wut, Ärger, Trauer, Verzweiflung
Kann bis zum Burnout führen
Der Unterschied liegt in der Intensität und den Auswirkungen. Wenn Selbstzweifel Dich lähmt statt motiviert, ist es Zeit zu handeln.
Besonders herausfordernd: Das Impostor-Syndrom bei Solopreneuren
Das Hochstapler-Syndrom zeigt sich besonders stark bei Selbstständigen und Solopreneuren. Warum?
Als Angestellter hast Du ein fixes Gehalt. Dein Wert wird (scheinbar) vom Unternehmen bestimmt. Du musst nicht ständig beweisen, was Du wert bist.
Als Solopreneur bist Du permanent mit dem Geldthema konfrontiert:
Bei der Akquise neuer Kunden
Beim Verkaufen Deiner Dienstleistungen
Bei Preisverhandlungen
Bei der Sichtbarkeit in sozialen Medien
Jede Kundenabsage fühlt sich wie eine persönliche Ablehnung an. Jeder Preis, den Du verlangst, wird zur Aussage über Deinen Selbstwert.
Hinzu kommt die Sichtbarkeit: Website erstellen, LinkedIn-Posts schreiben, sich vor die Kamera setzen – all das triggert die tief sitzende Angst vor Ablehnung.
Das Ergebnis? Selbstständige leiden übermäßig unter massiven Selbstzweifeln und dem ständigen Gefühl, nicht gut genug zu sein.
Mein Wendepunkt: „Wer nicht will, der hat”
Zurück zu meiner Geschichte vom Anfang. Wie bin ich aus diesem Teufelskreis herausgekommen?
Der entscheidende Moment war eine Erkenntnis: Ich musste zwei Dinge voneinander trennen.
Vorher: Ich definierte meine Preise aus Wut und dem Bedürfnis, mich zu beweisen. Ich wollte anderen zeigen, dass ich wertvoll bin. Das waren "angry negotiations"… zum Scheitern verurteilt.
Nachher: Ich erkannte, dass ich mein Angebot und meine Preise definiere, weil ich an das glaube, was ich tue. Ich habe entsprechende Referenzen und Ergebnisse. Punkt.
Die Kernfrage wurde: Glaube ich an den Wert dessen, was ich anbiete?
Wenn die Antwort „Ja” ist, dann ist der Preis gerechtfertigt. Wenn jemand nicht bereit ist zu zahlen, ist das okay. „Wer nicht will, der hat.”
Diese Trennung von persönlichem Wert und Angebotswert war befreiend.
Strategien zur bewältigung des Imposter-Syndroms
1. Erkenne Deine Muster
Welcher der vier Impostor-Typen bist Du hauptsächlich? In welchen Situationen fühlst Du Dich besonders wie ein Hochstapler?
Übung: Führe eine Woche lang ein „Impostor-Tagebuch”. Notiere Dir jeden Moment, in dem Du Dich wie ein Betrüger fühlst. Was war der Auslöser?
2. Finde die Ursprünge
Welche Botschaften hast Du als Kind über Erfolg, Geld oder Kompetenz erhalten? Welche Sätze Deiner Eltern oder Lehrer hörst Du heute noch in Deinem Kopf?
Das Ziel ist nicht, Deine Eltern zu verurteilen, sondern zu verstehen, woher diese Muster kommen.
3. Trenne Fakten von Gefühlen
Wenn das Impostor-Gefühl auftaucht, frage Dich:
Welche objektiven Beweise sprechen für meine Kompetenz?
Was sagen andere über meine Arbeit?
Welche Erfolge habe ich bereits erzielt?
Deine eigene Leistung subjektiv zu bewerten ist normal, aber lass die Fakten auch zu Wort kommen.
4. Übe Dich im Komplimente annehmen
Menschen mit Impostor-Syndrom betroffen tun sich schwer damit, Lob und Anerkennung anzunehmen. Sie wiegeln ab: „Das war nichts Besonderes” oder „Das hätte jeder geschafft.”
Neue Regel: Wenn jemand Dich lobt, sag einfach „Danke.” Punkt. Keine Relativierung, keine Erklärung.
5. Baue soziale Unterstützung auf
Du bist nicht allein mit diesen Gefühlen. Suche Dir Menschen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Das können Kollegen sein, eine Selbsthilfegruppe oder ein Community von Gleichgesinnten.
Der Austausch zeigt Dir: Du bist normal. Fast jeder erfolgreiche Mensch kennt diese Zweifel.
Wann professionelle Hilfe sinnvoll ist
Das Impostor-Syndrom zu überwinden ist nicht immer ein DIY-Projekt. Wann solltest Du Dir Hilfe suchen?
Wenn die Selbstzweifel Dein psychisches Wohlbefinden massiv beeinträchtigen
Wenn Du wichtige Chancen ablehnst aus Angst, „entlarvt” zu werden
Wenn Du unter Angststörungen oder depressiven Verstimmungen leidest
Wenn das Hochstapler-Syndrom zu einer echten psychischen Belastung wird
Psychotherapie kann Dir helfen, die tiefer liegenden Entwicklungstraumata zu bearbeiten. Ein erfahrener (Business-) Coach kann Dich dabei unterstützen, konkrete Strategien zur Bewältigung des Imposter-Syndroms zu entwickeln.
Du musst das nicht allein schaffen. Melde Dich gerne für ein Erstgespräch bei mir.
Eine andere Perspektive: Impostor-Gefühle als Kompass
Hier ist ein ungewöhnlicher Gedanke: Was, wenn Deine Impostor-Gefühle Dir etwas Wichtiges sagen?
Oft treten sie genau dann auf, wenn Du kurz davor stehst, Dich weiterzuentwickeln. Wenn Du eine neue Rolle übernimmst, ein größeres Projekt angehst oder mehr Verantwortung trägst.
Vielleicht sind sie ein Zeichen dafür, dass Du wächst.
Das Ziel ist nicht, diese Gefühle komplett loszuwerden, sondern zu lernen, trotz ihrer Anwesenheit zu handeln.
Erfolgreiche Menschen sind nicht die, die keine Selbstzweifel haben. Es sind die, die trotz Selbstzweifel handeln.
Der Weg nach vorn
Das Impostor-Syndrom zu überwinden ist ein Prozess, kein Schalter, den Du einfach umlegst.
Es beginnt mit der Erkenntnis:
Diese Gefühle sind real, aber sie sind nicht die Wahrheit über Dich.
Du bist nicht der Hochstapler, für den Du Dich hältst. Du bist auch nicht perfekt. Du bist ein Mensch mit Stärken und Schwächen, mit Erfolgen und Fehlern.
Und das ist völlig in Ordnung.
Die Menschen, die Deine Hilfe brauchen – ob als Kollege, Chef, Selbstständiger oder in welcher Rolle auch immer – brauchen genau das: Einen authentischen Menschen, der sein Bestes gibt.
Nicht mehr, nicht weniger.
Das bist Du bereits. Du musst es nur erkennen.
Häufig gestellte Fragen zum Impostor Syndrom
-
Nein, das Impostor-Syndrom ist keine offizielle psychische Erkrankung. Es ist vielmehr ein psychologisches Phänomen, das oft als Symptom eines Entwicklungstraumas auftritt. Wenn der Leidensdruck jedoch sehr hoch ist, kann professionelle Unterstützung durch Psychotherapie sinnvoll sein.
-
Typische Anzeichen sind:
Du schreibst Erfolge dem Glück oder äußeren Umständen zu, hast massive Selbstzweifel trotz guter Leistungen, vermeidest Herausforderungen aus Angst vor dem Scheitern, oder fühlst Dich wie ein Betrüger, wenn andere Dich loben.
Kurz: Du kannst Dir Erfolg nicht zugestehen und genießen.
-
Das Impostor-Syndrom lässt sich nicht „heilen” wie eine Krankheit, aber es kann überwunden werden. Strategien zur Bewältigung des Imposter-Syndroms umfassen Selbstreflexion, das Erkennen von Denkmustern, soziale Unterstützung und bei Bedarf professionelle Hilfe durch Coaching oder Therapie.
-
Die ursprüngliche Forschung von Clance und Imes fokussierte auf Frauen, aber inzwischen zeigen Studien, dass Menschen aller Geschlechter gleichermaßen betroffen sein können. Die Ausprägung kann sich unterscheiden, aber das Grundgefühl ist universell.